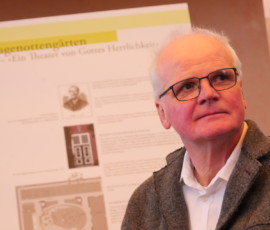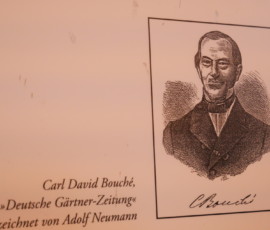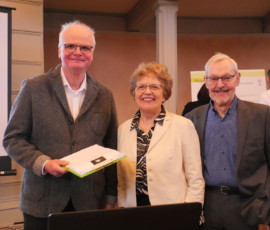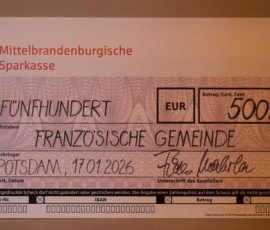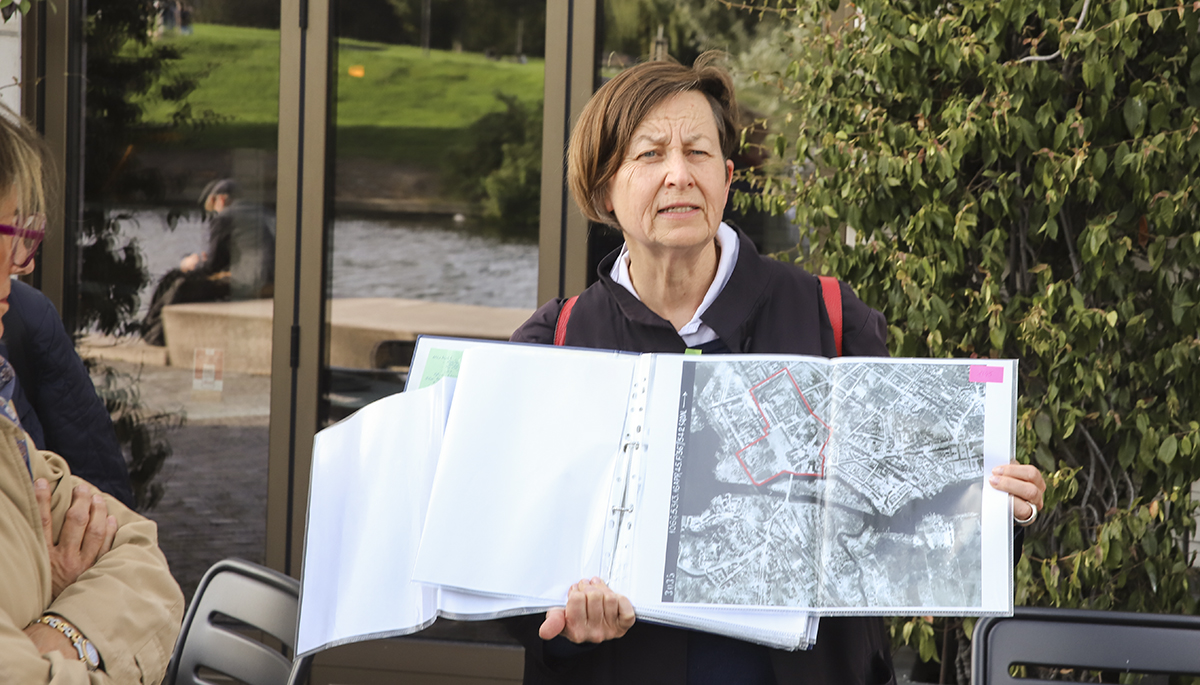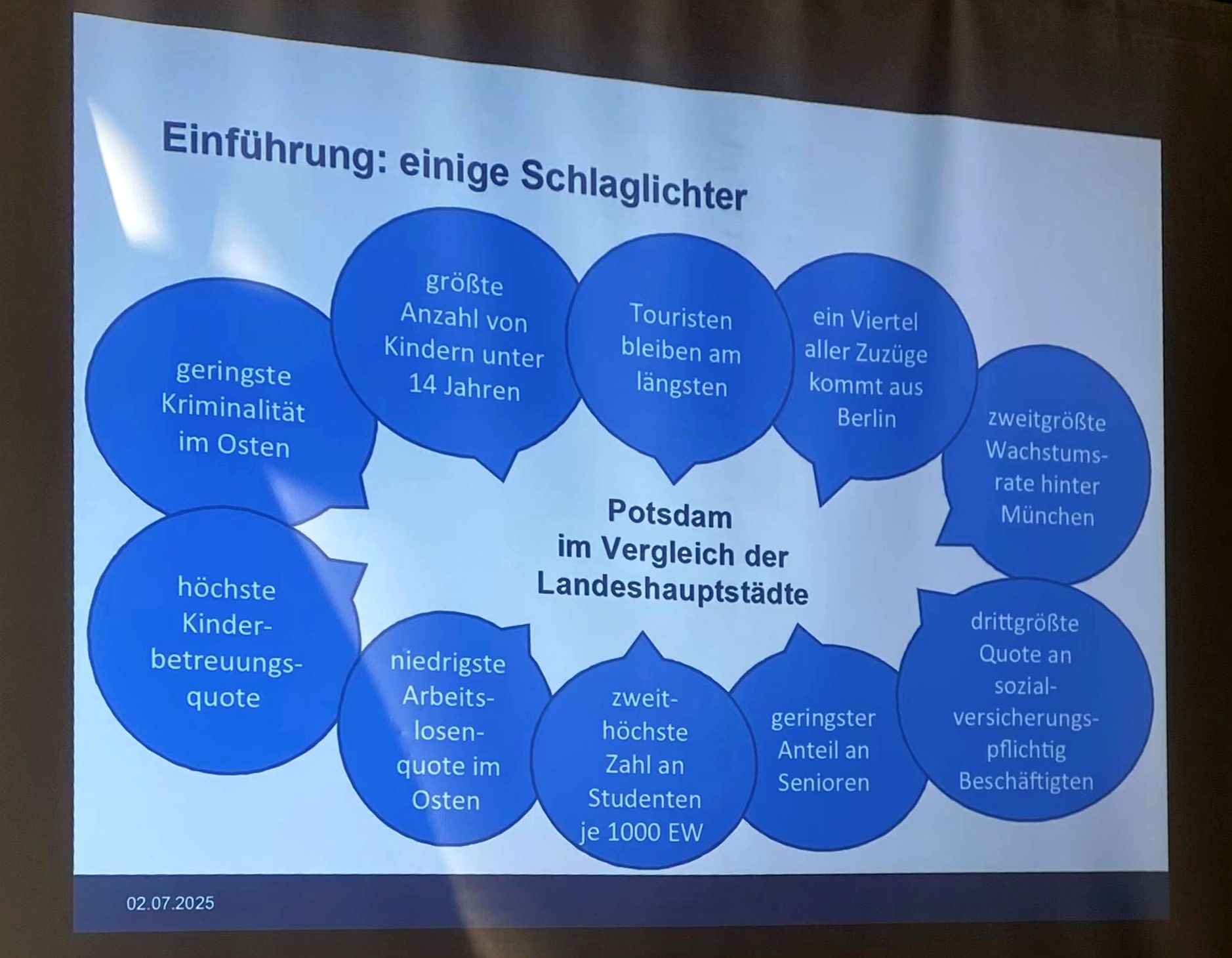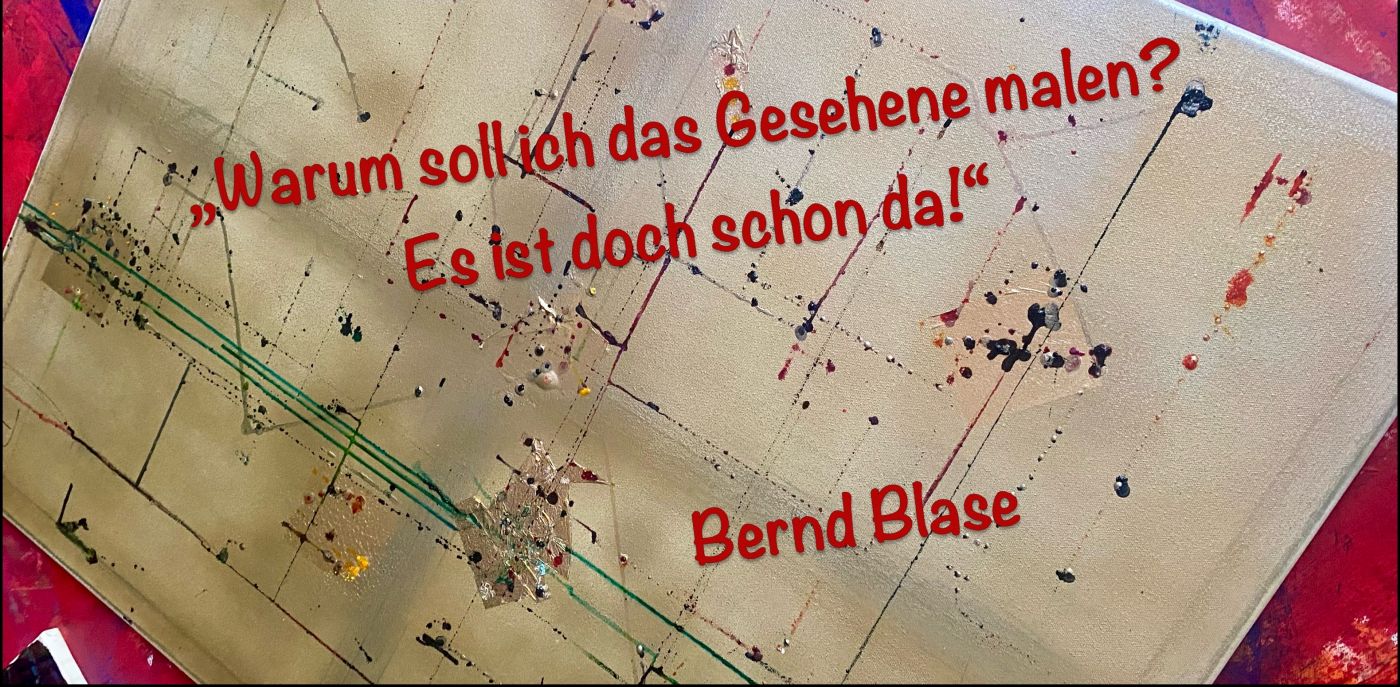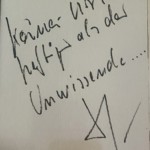Über unseren Verein
Wir lieben unsere Stadt und genießen sehr bewusst die vielfältigen kulturellen Angebote. Mit unserer Begeisterung wollen wir andere anstecken. Mit unseren Projekten kommunizieren wir Potsdam als eine Stadt der Kultur, als Stadt der Gastfreundlichkeit, der Toleranz und Weltoffenheit. Unser Verein fördert das Engagement der Bürger und fördert Kultur.